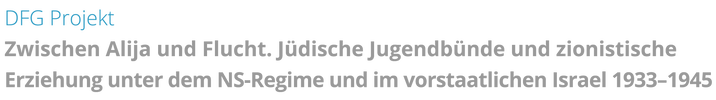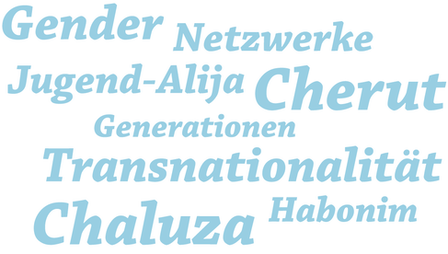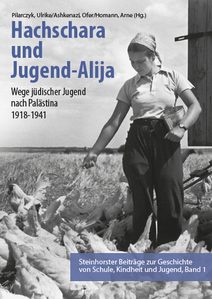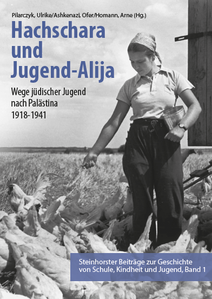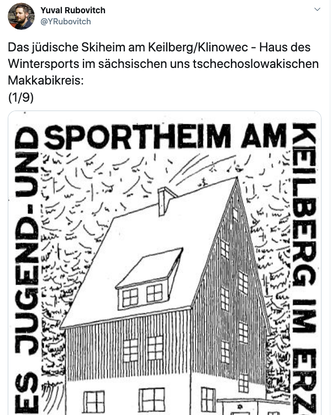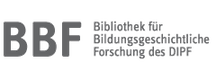Der notwendige Aufbau einer Datenbank stand schon von Beginn der Überlegungen an als eine wichtige Säule des Netzwerk-Projektes “Hachschara als Erinnerungsort” fest. Vor allem weil in verschiedenen Veröffentlichungen zur Thematik die unterschiedlichsten Zahlen und Behauptungen auftauchten. Sowohl was den Umfang, als auch die Geschichte der einzelnen Hachschara-Orte anging, braucht es also Klärung. Die Datenbank soll nun einen genaueren Überblick genau zu diesen Fragen geben und im Resultat müsste es dann möglich sein, sich dem Projekt „Hachschara in Deutschland“ (und mit der Einbeziehung der Auslandshachschara auch in Europa) verlässlicher nähern zu können. In Zusammenarbeit des Moses Mendelsohn Zentrum in Potsdam (MMZ) mit dem DFG-Projekt „Nationaljüdische Jugendkultur…“ (seit 2023 unter dem neuen Titel: Zwischen Alija und Flucht…) an der TU Braunschweig wurde im letzten Jahr intensiv am Aufbau einer solchen Datenbank gearbeitet. Dabei ging es zunächst darum, was beschrieben werden müsste, und wie so eine Datenbank strukturiert werden sollte. Zeitgleich wurde einige Forscher*innen - die mit dem Thema vertraut sind – mit der Bitte angeschrieben einen Beitrag zu „ihrem“ Hachschara-Ort zu verfassen. Auf der „Weihnukka“-Veranstaltung des MMZ am 12. Dezember 2022 wurde diese Datenbank nun erstmals einer Öffentlichkeit präsentiert. Bisher wurden 10 Hachschara-Orte detailliert beschrieben, dazu kommen noch circa 70 Orte die auf einer Karte aufgenommen wurden (und die auf eine Beschreibung warten). Damit sind jedoch noch nicht alle bisher bekannten Hachschara-Orte erfasst. Die Datenbank wird in Zukunft (hoffentlich) auch „work-in-progress“ sein, sowohl was den Umfang der Erkenntnisse als auch die Qualität der Beiträge angeht. Erste Reaktionen auf die Veröffentlichung der Seite geben jedenfalls allen Grund zum Optimismus. https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ Kontakt: info[at]hachschara-erinnerung.de KB Wie an den Programmen der ersten Arbeitstagung des DFG-Projektes, 2019 in Steinhorst, und der Konferenz vom März 2021 abzulesen ist, war Hachschara immer ein wichtiger Bestandteil unserer Projektarbeit. Nun gibt es ein Projekt-im-Projekt, das sich speziell mit Fragen von Hachschara und den Orten, an denen sie stattfand, beschäftigen soll. Der Projektname „Hachschara als Erinnerungsort“ soll dabei Programm sein. Angefangen hat es für uns mit einer email von Arnold Bischinger (Neuendorf im Sande), in dem er über den geplanten Verkauf von Skaby, einer ehemaligen Hachschara bei Spreenhagen, berichtete. Selbstverständlich kann nicht jeder Ort an dem Hachschara stattfand in ein Museum verwandelt werden, so unsere Gedanken, aber zumindest sollten die Orte öffentlich zugänglich bleiben und dort zugleich an die Geschichte der Hachschara erinnert werden. Weiter lesen Ich würde die Behauptung aufstellen, fände sich heutzutage irgendwo ein Kreis von Forscher*innen zur Jugendbewegung und käme das Gespräch auf die wohl wichtigsten Publikationen in diesem Forschungsfeld, fiele ohne jeden Zweifel bald der Name von Walter Laqueur. Dabei ist sein Band, der sehr schlicht den Titel: „Die deutsche Jugendbewegung“ trägt, schon vor fast 60 Jahren erschienen. Stellt sich die Frage, woher, in der eher schnelllebigen akademischen Wahrnehmung, dessen langlebige Bedeutung herrührt? Meiner Meinung nach sind es vor allem die genaue Wahrnehmung, intime Kenntnis des Forschungsgegenstandes und eine verständliche Sprache, die das Buch auszeichnen und zeitlos lesbar machen. Hier schrieb jemand, der sowohl das Handwerk des Journalisten als auch des Historikers gleichermaßen beherrschte, lesbar, pointiert und doch mit Präzision. Zudem war der Autor ein Kenner der Jugendbewegung, der das Phänomen zudem aus eigenem Erleben kannte und dennoch genug Abstand besaß sich ohne süßliche Verklärung seinem Forschungs-Gegenstand nähern zu können. Letzteres war, gerade in Anbetracht von Verstrickungen aus der Jugendbewegung und ehemaliger Jugendbewegter mit dem Nationalsozialismus, zu jener Zeit nicht selbstverständlich. Weiter lesen
Der Ort im ehemaligen Niederschlesien, in dem sich junge Jüdinnen und Juden in den 1930er Jahren auf ihre Auswanderung vorbereiten konnten, scheint zu boomen, derzeit nicht nur als Urlaubsresort, sondern auch in der historischen Wahrnehmung, davon zeugen zwei kürzlich erschienene Aufsätze. Barbara Stambolis vermittelt in ihrem Beitrag: „Wir dürfen über dem Acker die Sterne nicht verlieren“ erschienen im Konferenzband „Flucht und Rückkehr. Deutsch-jüdische Lebenswege nach 1933“ (S. 103-119) einen kursorischen Überblick über die Aktivitäten in Groß Breesen und verbindet das mit dem Versuch, das Auswanderungsgut im Kontext der Jugendbewegung zu verorten. Als Quellen dafür hat sie den Bestand der inzwischen digitalisierten Rundbriefe der Groß Breesener, die von 1938 bis 2003 erschienen, gewählt und mit Verweisen auf einschlägige Literatur angereichert. Negativ fallen hier allerdings einige Fehler ins Gewicht. Am harmlosesten wahrscheinlich die Eckdaten, denn das Auswanderungsgut in Groß Breesen existierte von 1936 bis 1943 und nicht von 1935 bis 1942, wie Stambolis irrtümlich annimmt (S. 103). Die Behauptung jedoch, das Gut habe geholfen: die Jugendlichen „...auf ein Leben in Kibbuzim in Palästina/ Israel vor(zu)bereiten ...“ (S. 104) ist schlichtweg falsch, denn Groß-Breesen diente in den Jahren nach 1936 vor allem nichtzionistischen Jugendlichen zur Auswanderungsvorbereitung in Länder Nord- und Südamerikas. Frank Wolff kennt und beschreibt in seinem Aufsatz: „Der Traum vom deutsch-jüdischen Bauern“ im Sammelband „Was soll aus uns werden?“ (S. 195-237) die Ausgangslage für und Lebensbedingungen in Groß Breesen wesentlich sachkundiger und detaillierter. Weiter lesen
Nun nähert sich Yuval Rubovitch, in einem Buch über den Leipziger „Bar Kochba“, demselben Haus, nur von Seiten der jüdische Sportbewegung. Zu meiner Überraschung, ich hatte vermutet das Gebäude würde nicht mehr existieren, hat er den Ort gefunden und dokumentiert.
Neben der offiziellen und damit limitierten Einwanderung nach Palästina, setzten zionistische Organisationen ab Ende der 1930er Jahre verstärkt auch auf illegale Einwanderungsmöglichkeiten. Organisiert wurde das Ganze vom Mossad Alija Bet. Einer der ersten Transporte dieser Art aus Westeuropa war die Fahrt des Dampfers „Dora“, der im Juli 1939 aus den Niederlanden nach Palästina fuhr. Viele der Passagiere waren deutsche Chaluzim, die in den Niederlanden ihre Hachschara absolviert hatten. Der Initiative von Daniel Abraham, dessen Mutter Toni Katz zu den Passagieren gehört hatte, ist zu verdanken, dass wir nun mehr über diese Reise und die Passagiere erfahren können. Seine Website wird laufend aktualisiert und Daniel freut sich über zusätzliche Informationen. KB |
|
|
In Zusammenarbeit mit
DFG-Forschungsprojekt: „Zwischen Alija und Flucht. Jüdische Jugendbünde und zionistische Erziehung unter dem NS-Regime und im vorstaatlichen Israel 1933–1945.“
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrike Pilarczyk, +49 (0) 531-391 8807, ulrike.pilarczyk(at)tu-bs.de Technische Universität Braunschweig | Institut für Erziehungswissenschaft © 2023 |